Ein Interview von Christoph Müller mit Ulrich Thomas Wolfstädter
Für viele Menschen sorgt das Gendern in der Sprache für Irritationen. Ulrich ist nicht nur Nudist. Der freie Philosoph versteht sich als Mensch, nicht als Mensch*in. Mit dem Buch „Krieg der Gendersterne“ hat er sich mit gendergerechter Sprache tiefgründig und inhaltlich anspruchsvoll beschäftigt. Christoph Müller hat den Austausch mit ihm gesucht.
Christoph Müller
Jahrgang 1970, im Hauptberuf seit mehr als drei Jahrzehnten in der psychiatrischen Pflege tätig, im Nebenberuf langjährige redaktionelle und publizistische Tätigkeiten zu den Themen Pflege, Psychiatrie und Naturismus, Dozent in der Fortbildung von professionellen Pflegern.
Müller: „Krieg der Gendersterne“ heißt dein aktuelles Buch. Dies klingt nach „Star Wars“. Geht es dabei um das Miteinander der Geschlechter? Oder wirfst du einen Blick auf die gendergerechte Nutzung der Sprache?
Wolfstädter: Ja, Star Wars ist hier der Titelgeber! Und wie dort scheint auch im Diskurs um die gendergerechte Sprache der Rahmen vorgegeben zu sein: Das Gute kämpft gegen das Böse. Anders wie in Star Wars scheint allerdings im Kampf um die angemessene sprachliche Berücksichtigung aller Geschlechter nicht klar zu sein, wer die „Guten“ und wer die „Schlechten“ sind. Und, um deine Frage noch zu beantworten, worum es mir in meinem Buch geht, muss ich sagen, dass letztlich beides verfehlt ist. Es geht mir um das Miteinander von Menschen, in Unabhängigkeit ihrer genitalen Merkmale, also um die Nutzung der Sprache als solcher.
Müller: Was ist für dich die Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben? Was ärgert dich besonders im gesellschaftlichen Diskurs?
Wolfstädter: Das, was mich ärgert, ist zugleich meine Motivation über den Irrtum im durchaus ehrenwerten Ziel der gendergerechten Sprache aufzuklären. Unsere Gesellschaft ist so abgrundtief sexistisch, sodass niemandem mehr der Sexismus auffällt. Es gibt praktisch keinen Bereich mehr, wo das (zugeschriebene) Geschlecht keine Rolle spielt. Wir glauben, an unseren Genitalien die jeweilige Identität bestimmen – und dies dann auch sprachlich zum Ausdruck bringen zu müssen. Niemand stellt diesen Unsinn infrage. Oder würde es bzw. hätte es etwa geholfen, den Rassismus zu überwinden, indem alle dunkelhäutigen Menschen mit einem Suffix am Wortende versehen werden, um durch diese sprachliche Maßnahme ihre gesellschaftliche und politische Gleichstellung zu erreichen und Rassismen abzubauen? Das wird wohl kaum jemand bejahen! Warum sollte es also beim Geschlecht anders sein? Ich glaube daher, dass wir vielmehr lernen müssen, von vorneherein einfach den Menschen (Betonung Wolfstädter) zu sehen und nicht erst unter Berücksichtigung seiner vermeintlich identitätsstiftenden Genitalien.
Müller: Im Alltag sind wir bemüht, gendergerecht zu sprechen und zu schreiben. Du dokumentierst, dass es keine wissenschaftliche Begründung dafür gibt. Warum sollen wir es möglicherweise trotzdem tun?
Wolfstädter: (lacht) Theoretisch deshalb, weil man glaubt, „Geschlechter“ in die Gleichberechtigung bringen zu müssen. Doch damit leidet das Bemühen um die Gleichberechtigung immer unter den Bedingungen divergenter Identitätszuschreibungen, die wunderbar mit Rollenbildern und Hierarchisierungen versehen werden können. Denn wenn wir Geschlechtsidentitäten haben und sie immer wieder sprachlich zum Ausdruck bringen, dann sedimentieren wir damit das Fundament für Hierarchisierungen von Rollenbildern und Stereotypen, was wir vorgeblich überwinden wollen. Das ehrenwerte Ziel, das mit der Genderlinguistik verfolgt wird, kolportiert sich also selbst. Das ist es, was auf gesellschaftlicher Ebene erkannt werden muss.
Müller: In der Sprache orientieren wir uns an dem Genus-Sexus-Prinzip. Was heißt dies eigentlich? Reicht es nicht, einfach tolerant zu leben und zu sprechen?
Wolfstädter: Das in der Sprachwissenschaft sogenannte Genus-Sexus-Prinzip geht der Frage nach, ob es zwischen dem grammatikalischen Geschlecht (Genus) und dem biologischen Geschlecht (Sexus) eine Verbindung gibt. Ich jedenfalls kann keine finden, und es gibt auch keine. Und genau deshalb: Es reicht eigentlich tolerant zu leben und zu sprechen, wie du es zu bedenken gibst. Denn wenn es das Genus-Sexus-Prinzip nicht gibt bzw. es künstlich in unserer Kultur geschaffen wurde, und ja doch mehr Probleme aufwirft als gangbare Lösungswege aufzeigt, dann hält die Sprache bereits bereit (Betonung Wolfstädter), was wir im Grunde alle wollen: Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit. Aber nicht, weil Mann und Frau (Betonung Wolfstädter) sowie alles dazwischen oder darüber hinaus dies sind, sondern weil sie alle Menschen sind.
Es würde daher uns alle dem Ziel der Gleichbehandlung und -stellung aller Menschen näherbringen, wenn wir uns auf das besinnen, was die Sprache vermag, sprich schlicht und ergreifend von Schülern, Einwohnern oder Bäckern zu sprechen. Denn damit sind selbst jene Menschen „mitgemeint“, die einen Penis haben!
Müller: Du betonst, dass die sprachfeministische Gegenwehr auf emotionaler Ebene und im Rahmen des kultürlich konditionierten und sozialisierten Sprachgebrauchs verständlich sein kann. Ist es möglich, einen Bogen zum Nudismus zu schlagen?
Wolfstädter: In meinen Büchern lege ich dar, dass die sprachlich bemühte Sichtbarmachung der Geschlechtsidentitäten von der verschämten Verhüllung der Genitalien, wie sie in unserer Kultur und Gesellschaft vorherrscht, abhängt. Das heißt also, dass es die Genitalscham ist, die die gendergerechte Sprache bedingt. Das sage ich im Übrigen mit direktem Blick auf die Psychoanalytik Sigmund Freuds, weil die gesellschaftlich oktroyierte Genitalscham dafür sorgt, dass die Geschlechtsteile doch wieder einen Weg in die Sichtbarkeit finden. So geschieht dies derzeit verstärkt mithilfe der Schaffung von Geschlechtsidentitäten und des darauf abhebenden geschlechtsbezogenen Sprechens, also dem Gendern. Die Akzeptanz öffentlicher Nacktheit im Sinne des Naturismus auf gesellschaftlicher Ebene würde dem deutlich entgegenwirken, weil das Hauptaugenmerk nicht mehr auf dem unterdrückten Verborgenen läge und somit an Bedeutung verlöre, sondern auf der Akzeptanz des Menschen in Unabhängigkeit seines Geschlechts.
Müller: Inwieweit wäre es unter Nudisten aus deiner Sicht spannend, eine Diskussion zur (gendergerechten) Sprache zu führen? Braucht es in einer schweren Zeit den Diskurs unter Nackten, um am eigenen Selbstverständnis zu arbeiten?
Wolfstädter: Unbedingt! Mir ist völlig schleierhaft, weshalb ich ein geschlechtlich definierter (Betonung Wolfstädter) Nudist sein muss, um die Welt zu retten. Das Bemühen und der Kampf um Freiheit und Toleranz kann doch nicht davon abhängen, dass mein Genital, das mir meine zugeschriebene Geschlechtsidentität verleiht, sprachlich zum Ausdruck gebracht wird. Wenn ich mich für die Werte der Freiheit und der Toleranz einsetzen möchte, dann muss ich das unter Vernachlässigung körperlicher Merkmale, die Menschen haben, tun – wozu eben auch die primären Geschlechtsmerkmale zählen! Um den derzeit vorherrschenden Krisen begegnen zu können, reicht es meiner Ansicht nach, ein Nudist zu sein; sprich also kein/e Nudist*in, ganz gleich, ob ich nun weiblich oder männlich bin. Mehr noch: Es ist nahezu die Voraussetzung dafür (Betonung Wolfstädter). Denn gerade die Nacktheit macht uns als Menschen gleich, mitunter wenn unterschiedliche Genitalien kein Grund für Scham oder Hierarchisierungen sind. Genau das ist es aber, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eingeübt werden sollte.
Müller: Welche Impulse können wir von dir noch erwarten, die Brücken von der Philosophie zum Nudismus schlagen? Arbeitest du an einem weiteren Buch?
Wolfstädter: Nein, für die Theorie reicht es erst einmal. Jetzt möchte ich endlich Menschen erreichen, die ihrem Glauben nach mit dem schlichten Nacktsein in der Öffentlichkeit nichts zu tun haben. Denn das Thema geht jeden etwas an, ganz so wie es für alle in der Gesellschaft wichtig ist, sich beispielsweise mit der Homosexualität auseinanderzusetzen, – auch dann, wenn man nicht homosexuell ist. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das Nacktsein ganz praktisch aus- und vorzuleben. Wahrscheinlich erreiche ich auf diese Weise mehr Menschen für dieses wichtige Thema als mit der Lektüre eines dicken philosophischen Schmökers (lacht).
Müller: Wahrscheinlich ist das so! Aber ich denke auch, dass es eine theoretische Grundlage braucht, bei einem so sensiblen Thema.
Ich danke dir herzlich für das Gespräch, lieber Ulrich.
Das Buch, um das es geht:
U. T. Wolfstädter (2021). Krieg der Gendersterne. Berlin: Frank & Timme.
Warum die Gendersprache scheitern muss

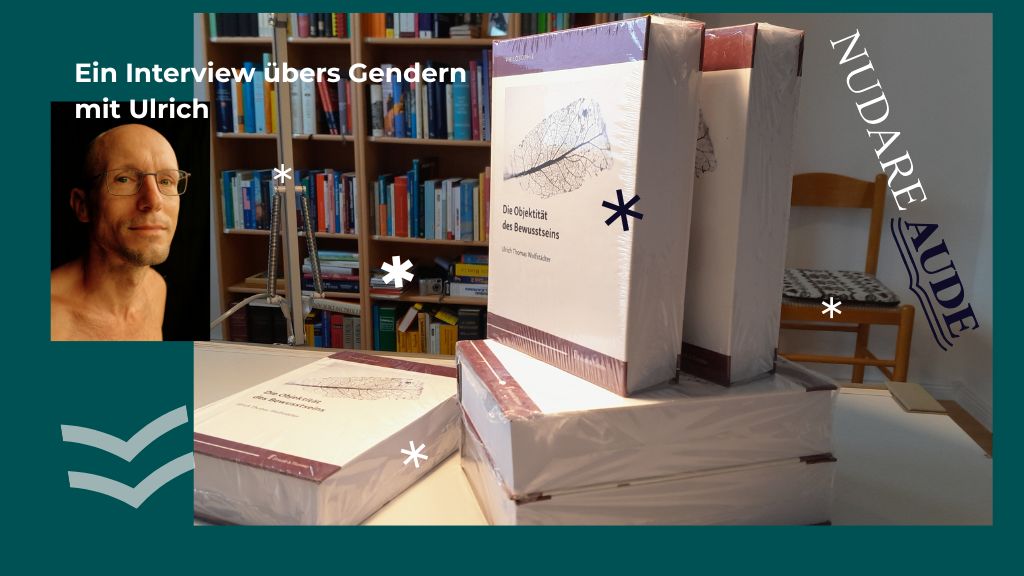
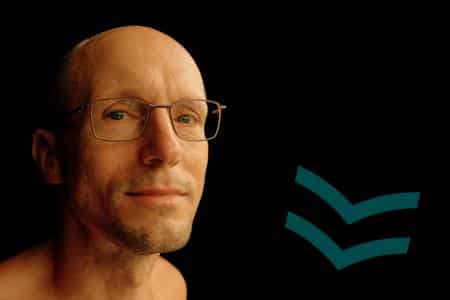
0 Kommentare